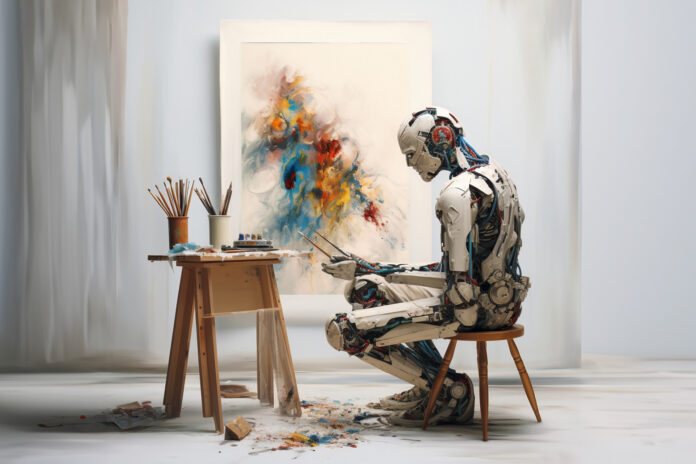Sprachassistenten, Smart-Home, autonomes Fahren – künstliche Intelligenz (KI) ist allgegenwärtig und spätestens seit ChatGPT präsenter als je zuvor. So spannend und faszinierend KI sein mag, so bringt sie doch auch rechtliche Herausforderungen mit sich. Besonders viele Fragen ergeben sich dabei im Bereich des Urheberrechts. Wie passt das auf analoge Werke ausgerichtete Urheberrecht mit digitalem, von einer KI generiertem Output zusammen? Der folgende Beitrag soll einen Überblick über die Herausforderungen geben, die sich für das Urheberrecht im Zusammenhang mit Output, der durch eine KI generiert wurde, stellen.
Urheberrechtlicher Schutz und KI-Output?
Voraussetzung für einen urheberrechtlichen Schutz von KI-Output ist, dass es sich dabei um ein „Werk“ i.S.d. § 2 Abs. 2 UrhG handelt. Unter einem „Werk“ ist demnach eine persönliche geistige Schöpfung zu verstehen, wobei die Schöpfung nur dann „persönlich“ ist, wenn es sich um eine menschlich-gestalterische Tätigkeit handelt. Dies ist vor allem im Hinblick auf die unterschiedlichen Arten von KI-Output von Bedeutung: Wenn die KI den urheberrechtlich zu bewertenden Output allein dergestalt generiert, dass alle wesentlichen Gestaltungsentscheidungen durch die KI getroffen werden, unterfällt ein solcher Output regelmäßig nicht dem urheberrechtlichen Schutz. Der Output wurde durch eine KI und nicht durch einen Menschen geschaffen, so dass die Tatbestandsvoraussetzung der „persönlichen geistigen Schöpfung“ nicht erfüllt ist.
Komplizierter ist der Fall, wenn sowohl Mensch als auch KI an dem Output beteiligt waren. Entscheidend ist hier, ob der menschliche Anteil an der endgültigen Formgestaltung des Outputs hinreichend ist, um diesen einem Menschen als Schöpfer zuzurechnen. Dabei kommt es vor allem darauf an, ob die KI lediglich als Werkzeug genutzt wird, um vom Schöpfer entwickelte Gestaltungsentscheidungen umzusetzen – ähnlich wie bei einem Pinsel oder Meißel – oder ob die Kontrolle über den Gestaltungsprozess und das Ergebnis bei der KI liegen. Ist Letzteres der Fall, fehlt es auch hier an einer persönlichen geistigen Schöpfung – mit der Folge, dass der entstandene Output keinen urheberrechtlichen Schutz genießt.
Aus dieser rechtlichen Situation ergeben sich für das Urheberrecht gleich mehrere Herausforderungen:
Zunächst stellt sich die Frage nach der Abgrenzung, wann ein Output einem Menschen und wann einer KI zuzurechnen ist. Anhand welcher Kriterien und Maßstäbe kann beurteilt werden, ob der menschliche Anteil bestimmend genug ist, damit der von der KI generierte Output urheberechtlichen Schutz genießt.
Die zweite Herausforderung ist dagegen eine rein praktische: Wie soll sich ohne Kenntnis des genauen Entstehungsprozesses feststellen lassen, wie hoch der menschliche Anteil an dem fraglichen Output ist und welcher Anteil der KI zufällt? Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur menschlichen Schöpfungen ein urheberrechtlicher Schutz zukommt, so dass ein starker Anreiz bestehen kann, den durch KI generierten Anteil nicht offenzulegen.
Geklärt werden muss schließlich, wie mit Output umgegangen werden soll, der kein „Werk“ i.S.d. § 2 Abs. 2 UrhG darstellt und somit keinen urheberrechtlichen Schutz genießt. Möglicherweise könnten hier Leistungsschutzrechte wie das Datenbankherstellerrecht (§ 87 UrhG) zum Tragen kommen. Sinnvoller wäre es aber, ggf. de lege ferenda ein eigenes Schutzsystem hierfür zu entwickeln.
Text- und Data-Mining
Damit eine künstliche Intelligenz „zum Leben“ erweckt werden kann, ist es notwendig, dass der ihr zugrundeliegende Algorithmus mit Hilfe von großen Datensätzen seine Leistungsfähigkeit trainiert (Text- und Data-Mining).
Dabei stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Verwendung von Datensätzen für das Trainieren von KI-Anwendungen rechtlich zulässig ist. In vielen Fällen muss für das Training auf Informationen zurückgegriffen werden, die in Fotos, Texten, Videos und anderen Datensätzen enthalten sind, und die ihrerseits urheberrechtlichem Schutz unterliegen können. Die Analyse im Rahmen des Trainierens von KI-Anwendungen kann somit als solche ggf. in fremde Urheberrechte eingreifen. So müssen entsprechende Daten beispielsweise für jede automatisierte Analyse in den Arbeitsspeicher des Computers geladen werden. Dadurch entstehen Vervielfältigungen und ggf. auch Bearbeitungen, die ihrerseits eine Verletzung des Vervielfältigungsrechts (§ 16 UrhG) bzw. einen Verstoß gegen § 23 UrhG darstellen können.
Bis Juni 2021 war in Deutschland für die Nutzung solcher Daten eine Erlaubnis des Urhebers erforderlich, sofern die Vervielfältigungen nicht für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erfolgten (§ 60d UrhG a.F.). Folglich musste für ein kommerzielles Text- und Data-Mining die Erlaubnis des jeweiligen Urhebers eingeholt werden, was angesichts des Umfangs der benötigten Datenmengen faktisch unmöglich war.
Um dieses Problem zu beheben, technische Innovationen zu fördern und für Unternehmen gleichzeitig einen sicheren Rechtsrahmen für KI-Anwendungen zu schaffen, hat der europäische Gesetzgeber 2019 mit der DSM-Richtlinie (RL (EU) 2019/790 vom 17.04.2019) eine Schrankenregelung für maschinelles Lernen eingeführt. Diese hat der deutsche Gesetzgeber in § 44b UrhG umgesetzt. Sie ist am 07.06.2021 in Kraft getreten.
Gemäß § 44b UrhG zulässig sind „[…] Vervielfältigungen von rechtmäßig zugänglichen Werken für das Text und Data Mining. […] Nutzungen sind [jedoch] nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat.“ Damit besteht eine (allgemeine) gesetzliche Erlaubnis, urheberrechtlich geschützte Werke zu sammeln und damit Trainingsdaten zu erstellen. Die Schranke ist dabei nicht mehr auf Forschungszwecke beschränkt, sondern gilt gerade auch für kommerzielle Zwecke (BT-Drs. 19/27426, 87).
Zu beachten sind dabei drei wesentliche Voraussetzungen:
- Nur rechtmäßig zugängliche Werke dürfen für Text- und Data-Mining verwendet werden. Das ist der Fall, wenn das Werk abgerufen werden kann, ohne dass der Nutzer dabei einen Rechtsverstoß begeht.
- Die Trainingsdaten müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr für Text- und Data-Mining benötigt werden. Eine Speicherung z.B. über ein bestimmtes KI-Projekt hinaus ist daher ausgeschlossen.
- Die Schranke des § 44b UrhG kommt nicht zum Tragen, wenn sich der Rechtsinhaber die Nutzung vorbehalten hat. Der Urheber muss also selbst aktiv werden, wenn er eine Nutzung seiner urheberrechtlich geschützten Werke zum Zwecke von Text- und Data-Mining verhindern möchte.
Rechtsverletzung durch KI-generierten Output
Nutzer von KI-Anwendungen müssen sich die Frage stellen, ob der Output, der durch die KI erstellt wurde, eine Urheberrechtsverletzung darstellen kann.
Anders als bei der Schaffung eines urheberrechtlich geschützten Werks ist für eine Verletzung von Urheberrechten keine persönlich-geistige Schöpfung notwendig. Auch ein KI-generierter Output, der seinerseits kein Werk im urheberrechtlichen Sinne darstellt, kann dementsprechend bestehende Urheberrechte verletzen. Ob der KI-Output in die Urheberrechte eines Dritten eingreift, richtet sich danach, ob der Output beispielsweise eine Vervielfältigung (§ 16 UrhG) oder eine Bearbeitung (§ 23 UrhG) darstellt. Handelt es sich hingegen um keine urheberrechtlich relevante Nutzung, kommt auch eine urheberrechtliche Verletzungshandlung nicht in Betracht.
Die Frage nach der Abgrenzung zwischen Bearbeitung und einer urheberrechtlich nicht relevanten Nutzung stellte sich bereits in der „analogen Welt“ in vielfacher Art und Weise. Entscheidend dürfte auch in Bezug auf einen KI-generierten Output sein, welchen Abstand der Output zu dem ursprünglichen Werk aufweist. Das ist eine Frage des Einzelfalls: Weist der durch die KI generierte Output einen hinreichenden Abstand zum ursprünglichen Werk auf, ist eine Zustimmung des Urhebers des ursprünglichen Werks entbehrlich. Andernfalls liegt eine unfreie Bearbeitung vor, die – ohne entsprechende Gestattung durch den Urheber – grundsätzlich eine urheberechtlich relevante Verletzungshandlung darstellt.
Sofern eine Vervielfältigung oder unfreie Bearbeitung anzunehmen ist, steht dem Urheber gegen den KI-Nutzer ein verschuldensunabhängiger Unterlassungsanspruch gemäß § 97 Abs. 1 UrhG zu. Eine Urheberrechtsverletzung liegt dabei immer dann vor, wenn der KI-Nutzer den durch die KI generierten Output selbst öffentlich zugänglich macht. In Betracht kommt außerdem ein Schadensersatzanspruch aus § 97 Abs. 2 UrhG. Voraussetzung hierfür ist zusätzlich ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln. Fehler der KI, die für den Nutzer nicht zu erkennen waren, können ihm dabei nicht zugerechnet werden.
Dennoch können sich KI-Nutzer wohl eher selten darauf berufen, dass sie Funktionen der KI nicht abschätzen oder kennen konnten und den Output trotzdem verwendet haben. Es liegt daher in der Verantwortung des Nutzers, Inhalte, die durch KI generiert wurden, im Einzelnen zu überprüfen. Tut er dies nicht, begeht er in der Regel eine Sorgfaltspflichtverletzung und der Urheber kann ihn für Rechtsverletzungen, die durch den Einsatz einer KI verursacht werden, haftbar machen.
Zusammenfassung
Ein durch KI generierter Output stellt das Urheberrecht vor mehrere Herausforderungen. Allerdings sind nicht alle Herausforderungen neu. Die Abgrenzungsfragen in Bezug auf erlaubnispflichtige Bearbeitung bzw. urheberrechtlich nicht relevante Nutzung sowie die Verwendung von Computerprogrammen als technisches Hilfsmittel sind dem Urheberrecht nicht fremd und mit dem bereits verfügbaren urheberrechtlichen Instrumentarium zu lösen. Soll der durch eine KI generierte Output im Einzelfall bewertet werden, bedarf es hierzu entsprechender Maßstäbe, die von der Rechtsprechung zu entwickeln sind. Andere Herausforderungen dürfen zumindest einstweilen als gelöst gelten – beispielsweise die grundsätzliche Zulässigkeit eines kommerziellen Text- und Data-Minings (auch ohne Erlaubnis der betroffenen Urheber). Letztlich sind aber auch einige neue Herausforderungen zu bewältigen. Dies gilt namentlich für die Frage, wie mit nicht urheberrechtlich schutzfähigem Output umgegangen werden soll und wie festgestellt werden kann, wie groß der jeweilige menschliche bzw. technische Anteil an KI-generiertem Output ist.
Autor

EY Law, Stuttgart
Rechtsanwalt, Partner
sebastian.eckhardt@de.ey.com
www.de.ey.com
Autor

EY Law, Stuttgart
Wirtschaftsjuristin
sophia.luettel@de.ey.com
www.de.ey.com